Hindernisse beim Windenergieausbau in Sachsen
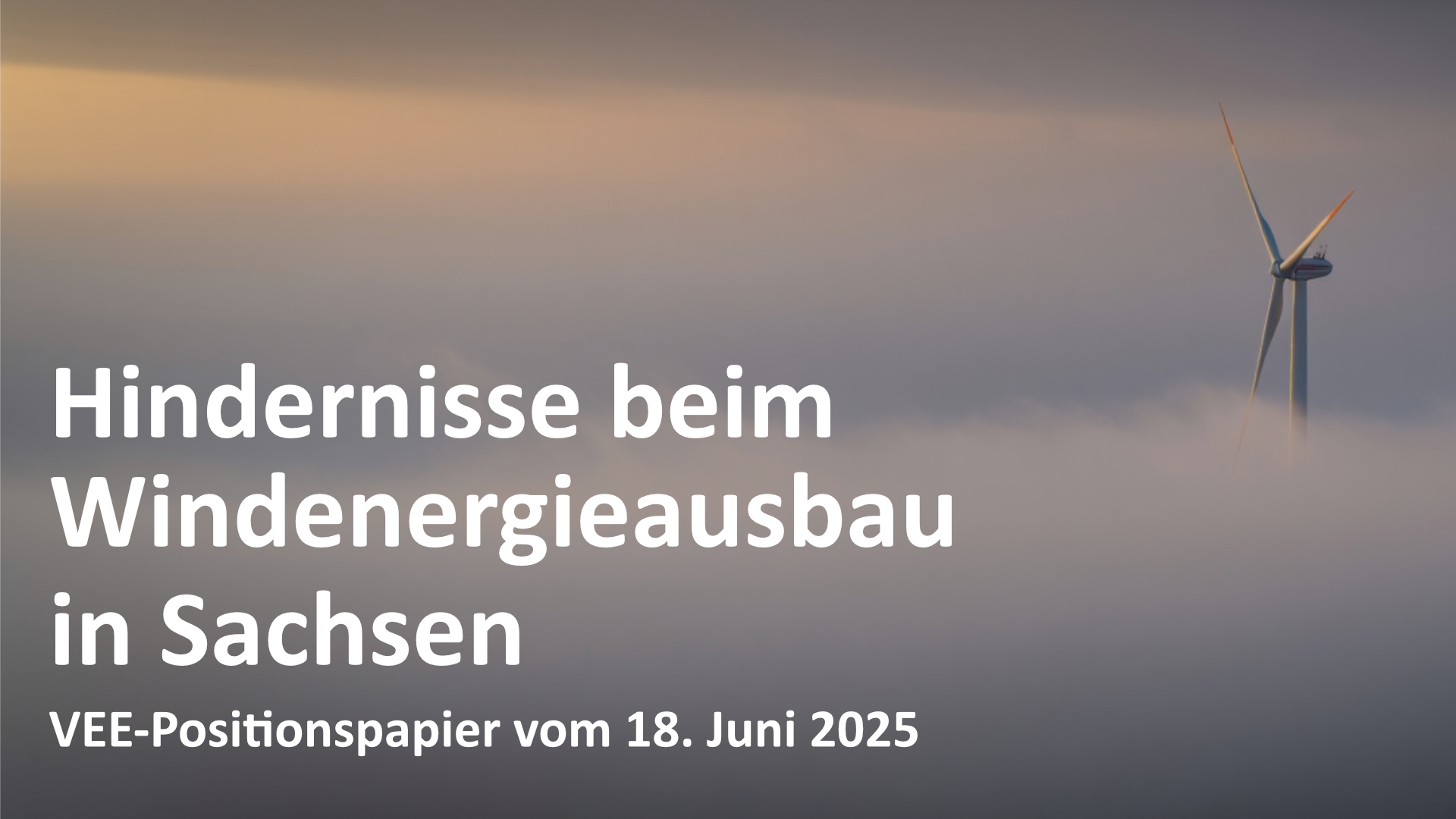
VEE-Positionspapier "Hindernisse beim Windenergieausbau in Sachsen"
V1.0 - 18. Juni 2025
1. Kommunikation
Situationsbeschreibung:
Die sächsische Spitzenpolitik hat eine Vorbildfunktion bei Transformationsprozessen wie der Energiewende – und nimmt sie nicht wahr. Das hat Folgen im gesamten Staatsapparat bis hin zur Umsetzung in den regionalen Planungsverbänden.
In Sachsen ist die öffentliche Kommunikation zur Windenergie seitens der politischen Entscheidungsträger bislang zurückhaltend. Dies wird unter anderem mit einer laut Sachsen-Monitor 2024 verbreiteten Skepsis in Teilen der Bevölkerung gegenüber Windenergieprojekten begründet (vgl. Sachsenmonitor-Umfrage 2024). Seit geraumer Zeit füllen NGOs wie „Gegenwind“ die Lücke aus – mit offiziell gestalteten, pseudo-demokratischen Petitionen wie der „Meißner Erklärung“.
Befürworter schweigen oder gehen in der öffentlichen Wahrnehmung unter. Es fehlt ein klares Bekenntnis der Regierung zu den Erneuerbaren Energien, wie sie es auch im Koalitionsvertrag vereinbart hat. Eine klare und faktenbasierte Kommunikation über die Potenziale und Herausforderungen der Windenergie kann zur Versachlichung der Debatte beitragen – und eine Signalwirkung für ausführende Organe wie die Planungsverbände.
Lösungsvorschlag:
- Eine positive Kommunikation zur Energiewende seitens der Landesregierung, die wirtschaftliche und ökologische Vorteile der Windenergie betont.
- Dabei sollten Narrative entwickelt werden, die regionale Wertschöpfung, kommunale Beteiligung, wirtschaftliche Standortvorteile und Krisenautonomie in den Vordergrund stellen.
- Fortschreibung des LEP2013 mit Fixierung des Ausbauzieles der EE und proaktiver Kommunikation zur Unterstützung der Energiewende.
2. Staatliche Rahmenbedingungen
Situationsbeschreibung:
Die Zuständigkeit für Energiefragen ist in Sachsen auf mehrere Ministerien verteilt. Dies erschwert die Koordination und Umsetzung der Energiewende in Sachsen.
Der Zuschnitt der Ministerien ist aus Perspektive der Windindustrie ungünstig. Eine sachgemäße, konstruktive Kommunikation zwischen den Ministerien, wie sie es ein derart bedeutsames Thema verdienen würde, findet nicht statt. Die Aufteilung des Themas „Energie“ auf SMWAEK, SMUL und SMIL ist nicht zielführend. Dabei sind staatliche Rahmenbedingungen wie etwa das Instrument der Flexiklausel eher positiv einzuschätzen. Das Problem in Sachsen besteht in der Umsetzung.
Lösungsvorschlag:
- Eine kohärente Verwaltungsstruktur und regelmäßiger Austausch zwischen den beteiligten Ressorts für effizientere Maßnahmen. Interministerielle Zusammenarbeit ist insbesondere bei Querschnittsthemen wie der Energiewende entscheidend, um Zielkonflikte zu vermeiden und Synergien zu nutzen. Es braucht regelmäßigen interministeriellen Austausch zum Thema Erneuerbare und regelmäßige Arbeitstreffen mit der Branche.
- Eine gemeinsame Verständigung auf Konstruktivität im Thema, auch als Abgrenzung zur AfD.
3. Personeller Mangel in den Behörden
Situationsbeschreibung:
Es besteht aus unserer Sicht ein Mangel an qualifiziertem Personal in den Behörden – dieser muss behoben werden. Leider wurden Personalstellen in den Ministerien, die von fachlich qualifizierten Mitarbeitern im Energie- und Umweltbereich besetzt waren, in den letzten Jahren durch neue Mitarbeiter besetzt, die überwiegend eine allgemein ausgeprägte Vorbildung in der Verwaltung oder im juristischen Sinne haben. Der Ausbau erneuerbarer Energien erfordert jedoch spezifisches Wissen in Technik, Recht und Umweltplanung, das gerade hinsichtlich der komplexen Genehmigungsverfahren erforderlich ist.
Lösungsvorschlag:
- Fachlich qualifiziertes Personal ist eine zentrale Voraussetzung für effiziente Verwaltungsprozesse. Eine gezielte Personalentwicklung kann die Qualität und Geschwindigkeit von Entscheidungsprozessen verbessern.
4. Flächenausweisung bis 2027
Situationsbeschreibung:
Beim Thema „Flächenausweisung für Windenergie“ droht Sachsen selbstverschuldet zu scheitern.
Bislang hat nur der Regionale Planungsverband Leipzig-Westsachsen einen konkreten Entwurf zur Flächenausweisung für Windenergie veröffentlicht. In einigen Regionen, wie dem Raum Chemnitz, bestehen zudem Unsicherheiten hinsichtlich der rechtlichen Steuerung. Die gesetzlich vorgegebenen Fristen aus dem Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) setzen jedoch einen engen zeitlichen Rahmen.
Lösungsvorschlag:
- Die Flächenziele des Koalitionsvertrags müssen weiterverfolgt werden.
- Es sollten in diesem Jahr für alle Regionen Planentwürfe veröffentlicht werden, um die Erreichung des Flächenbeitragwertes gewährleisten zu können. Das schafft einerseits Planungssicherheit und Vertrauen bei gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Akteuren und schwächt langfristig Windenergie-kritische Stimmen.
- Um dem öffentlichen Druck aus Teilen der Bevölkerung begegnen zu können, kann ein konservativerer Ansatz ohne das 2%-Ziel verfolgt werden, sofern dieser rechtssicher und wirtschaftlich tragfähig ist.
5. LEP-Fortschreibung
Situationsbeschreibung:
Der aktuelle Landesentwicklungsplan (LEP) Sachsens stammt aus dem Jahr 2013 und berücksichtigt nicht die aktuellen energie- und klimapolitischen Zielsetzungen des Freistaats, wie das sächsische Energie- und Klimaprogramm aus dem Jahr 2021.
Darin sind Ziele und Handlungsschwerpunkte für Klimaschutz und Klimaanpassung in Sachsen festgelegt, darunter auch ambitionierte Ausbauziele für die erneuerbaren Energien. Auch im Bereich Repowering gibt es Neuerungen, die einfließen sollten. Weiterhin gilt es, Themen wie Wasserstoff, Stromspeicher und generell die Sektorenkopplung mit aufzunehmen.
Lösungsvorschlag:
- Mit einer gut gemachten LEP-Fortschreibung kann bewiesen werden, dass eine Energiewende funktioniert.
- Ein aktualisierter LEP kann als strategisches Steuerungsinstrument dienen, um die Energiewende auf Landesebene kohärent umzusetzen.
- Die Integration neuer Technologien und Zielsetzungen stärkt die Planungsgrundlage für Kommunen und Investoren. Ebenso können Themenfelder wie Systemdienlichkeit und Technologieoffenheit einfließen.
6. Netzausbau
Situationsbeschreibung:
Der Stromnetzausbau in Deutschland verläuft derzeit langsamer als erforderlich und belastet über die Netzentgelte Verbraucher wie Wirtschaft.
Es wäre dem deutschen Stromsystem dennoch nicht zuträglich, nun pauschal den Netzausbau dem Ausbau der Erneuerbaren vorzuziehen. Gleichzeitig ist die Einspeisung erneuerbarer Energien regional ungleich verteilt, was zu Netzengpässen führt. Es ist nach wie vor noch zu wenig Stromproduktion am Netz und die Doppelnutzung von Wind und PV bietet noch einiges ungenutztes Potenzial.
Lösungsvorschlag:
- Die Vorschläge der NVP-Studie sind konsequent umzusetzen.
- Ein beschleunigter Netzausbau ist notwendig, um die Integration erneuerbarer Energien zu ermöglichen. Dabei sollten Industriezentren priorisiert werden, um wirtschaftliche Stabilität zu sichern.
- Die gleichzeitige Förderung von Batteriespeichern kann Netzengpässe abmildern und die Versorgungssicherheit erhöhen.
- Auch Bürokratieabbau und Anreize für Verbraucher würden den Netzausbau beschleunigen.
- Besonders wichtig wäre jetzt, die Förderung des „SAB Sachsenkredit Energie + Speicher“ aufrechtzuerhalten oder auszubauen.
7. Industrieprivilegierung
Situationsbeschreibung:
Insbesondere die energieintensive Industrie ringt nach wie vor mit hohen Stromkosten und steht an der Schwelle zur Abwanderung.
Projektentwicklern und Anbietern von erneuerbaren Energien liegen diverse Anfragen der Industrie nach grünem Strom, Wasserstoff und Batteriespeichern vor. Der Bezug grünen Stroms ist in der Praxis jedoch oft nicht möglich, weil PPAs vor dem Hintergrund der EEG-Förderzuschläge zu unattraktiv angeboten werden und ein etwaiger eigenständig betriebener Windpark zu unsicher in der Umsetzung ist (keine Flächen verfügbar, zu anspruchsvolle Definition Eigenversorgung). Auf der anderen Seite hat die Industrie keine eigenen planungsrechtlichen Möglichkeiten zur Umsetzung dieser Projekte und muss auf einen mutigen Bürgermeister in näherer Umgebung hoffen.
Lösungsvorschlag:
- Auf Bundesebene Vorschlag aus „Eckpunkte einer Windenergie-an-Land-Strategie 2023“ zur Einführung einer gezielten Außenbereichsprivilegierung in unmittelbarer Nähe von Industrie- und Gewerbegebieten
- Möglichkeiten gezielter Investitionskostenförderung für EE-Park-erwerbende Betriebe eruieren
8. Steigende Rückbaubürgschaftshöhen
Situationsbeschreibung
Die Höhe der Rückbaubürgschaften für Windenergieanlagen variiert in Sachsen stark zwischen den Landkreisen. Das belastet Projektierer und Betreiber und könnte die Realisierung von wichtigen Windenergieprojekten in Sachsen gefährden.
Ein weiteres Problem ist die Uneinheitlichkeit der Berechnungsmethode der Bürgschaftshöhen, in den verschiedenen Landratsämtern. Insbesondere im Erzgebirgskreis werden die Hürden sehr hoch gesetzt. Diese Unterschiede führen zu einer zusätzlichen Unsicherheit und Komplexität für Projektierer, die in mehreren Regionen tätig sind. Die variierenden Anforderungen erschweren die Planung und Umsetzung von Projekten und können letztlich die Wettbewerbsfähigkeit der Windenergie in Sachsen beeinträchtigen.
Lösungsvorschlag:
- Eine Einführung einheitlicher Richtlinien für Rückbaubürgschaften in Sachsen, die für alle Landratsämter gelten. Dies würde nicht nur die Transparenz erhöhen, sondern auch die Planungssicherheit für Projektierer verbessern.
- Eine umfassende Überprüfung der aktuellen Rückbaubürgschaftshöhen, um sicherzustellen, dass diese angemessen und marktgerecht sind. Dabei sollte auch die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, Bürgschaften an die tatsächlichen Rückbaukosten anzupassen, um eine Überforderung der Projektierer zu vermeiden.
Dresden, 18. Juni 2025